Viktória Muka / Anneliese Rieger
Sprache – Identität – Grenzen
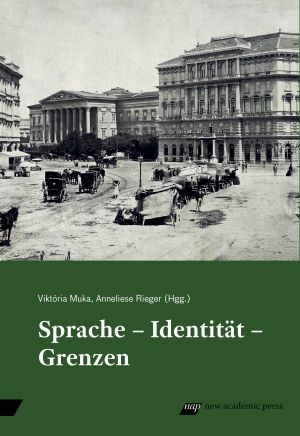
€ 22.00
Vorrätig
Von der Ukraine über Galizien, Österreich und Ungarn bis nach Tirol und Südtirol – mitteleuropäische Identität(en) unterliegen einem steten Wandlungsprozess. Dabei spiegeln sich geografische wie ideelle Grenzen in Fremd- und Selbstbildern von Völkern wider. Die vorliegenden Texte befassen sich in theoretischer wie exemplarischer Hinsicht mit Kultur- und Sprachpolitik in der Habsburgermonarchie, dem Spannungsverhältnis von Religion und Nationalismus und verhandeln Fragen der kulturellen Zugehörigkeit im Kontext von Literatur und politischer Emigration.
Die lateinische Wurzel des Wortes Identität, identidem, bedeutet immer wieder. Ein Vorgang, eine Haltung, eine Sprache, eine Erzählung oder eine Vorstellung werden durch die Wiederholung internalisiert.
Die Vielsprachigkeit des habsburgischen Raums ist zweifellos wesentlich für die Entwicklung der logisch-sprachanalytischen Methode in der österreichischen Philosophie. Multilinguale Räume formten die Doppelmonarchie nicht nur an den Grenzen, denn Wien, Prag oder Budapest waren zentrale Räume mit einer spezifisch mehrsprachigen Bevölkerung, die da und in peripheren Räumen nahezu automatisch zur individuellen Mehrsprachigkeit gelangte. Dies war die Basis jenes Phänomens, das Moritz Csäky mit „Mehrfachidentitäten“ umschrieb und das in allen Schichten der Bevölkerung anzutreffen war. So achteten bäuerliche Kreise in der Vojvodina darauf, dass ihre Kinder gleichermaßen das Ungarische, Serbische und Deutsche erlernten, so wie die Aristokratie ihre Kinder der feudalen Lebensweise entsprechend mehrsprachig erziehen ließ. […]
Neue Grenzen unter dem Postulat der Sprachnation schufen 1919/20 im zentraleuropäischen Raum neue Minderheiten, die einerseits zum Ankerpunkt revisionistischer Politik wurden und andererseits aggressiven Praktiken der Nationalisierungspolitik der Mehrheitsbevölkerungen ausgesetzt waren. Die individuelle Identität und die aufrechte Loyalität zum Staat wurden auf dem Altar einer apodiktisch angenommenen homogenen Nation geopfert. Aussiedlungspraktiken wie in Italien, die dem faschistischen Homogenisierungsterror folgten, ließen keinen Platz für „Mehrfachidentitäten“. […]
Der komplexe Prozess der Identitätsbildung einer Person und auch von Gruppen fußt auf der Wechselwirkung von Erziehung und individueller Wahrnehmung. Am konkreten Beispiel der österreichischen Slowenen kann dies auch nach dem demokratischen Neustart der Republik verdeutlicht werden. Während in Kärnten zunächst unter dem Schutz der Alliierten dem Slowenischen im Schulwesen des zweisprachigen Gebiets ein öffentlicher Raum über die Grenzen der Minderheit hinaus geschaffen wurde, dem allerdings nach der Wiederherstellung der Souveränität 1958/59 ein Ende bereitet wurde, verblieb man in der Steiermark bei der Praxis des Germanisierungsdrucks, indem alle Parteien anhaltend das Vorhandensein einer slowenischen Minderheit leugneten. Verschärft wurde diese Homogenisierungspolitik durch die Wiederkehr „deutscher Schutzvereinsarbeit“, die unter dem Deckmantel sozial engagierter Hilfe den Nationalisierungsdruck verstärkte. Der familiären Identitätsstiftung setzte man ein rein deutschsprachiges Schulsystem entgegen, in dem kein Platz für eine Mehrfachidentität blieb. Wie wichtig familiäre und gruppenspezifische Narrative besonders für die Identitätsstiftung von Volksgruppen sind, zeigt sich an der Situation Irlands und Südtirols ebenso wie am Beispiel der Kärntnerinnen und Kärntner und wohl auch der steirischen Sloweninnen und Slowenen. Wie wichtig aber sozioökonomische Parameter sind, zeigt die gesamtösterreichische Identitätsstiftung, die in einem geringeren Maße auf den politischen Landmarken – Wiedererrichtung der Republik, „Opferthese“ und Staatsvertrag – und in einem weitaus größeren auf dem Wirtschaftswunder fußt.
Dieter A. Binder im Vorwort zum Buch